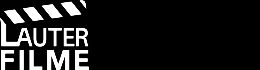Der nordirische Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Kenneth Branagh blickt mit seinen inzwischen 61 Jahren auf eine turbulente Karriere zurück. In jungen Jahren als der Mann gefeiert, der Shakespeare-Stoffe für die große Leinwand adaptieren konnte, bekam er in späteren Jahren für manche Projekte heftige Prügel. Nicht immer zu Unrecht. So ist sein „Artemis Fowl“ völlig missraten, auch „Tod auf dem Nil“ ist deutlich schwächer ausgefallen als der Vorgänger „Mord im Orient-Express„. In seinem bislang persönlichsten Projekt hat sich Branagh nun mit seiner eigenen Kindheit in den späten 60er Jahren im damals vom Bürgerkrieg geschüttelten „Belfast“ beschäftigt. Und dafür sieben Oscar-Nominierungen eingeheimst, darunter zwei für sich selbst (Drehbuch und Regie). Ist der Film wirklich so gut? Das klärt die Kritik.

Die Handlung
Der neunjährige Buddy (Jude Hill) lebt 1969 in Belfast in einer typischen Arbeitergegend. Sein Vater (Jamie Dornan) ist für seinen Job fast immer in England, so dass Buddys Mutter (Caitriona Balfe, „Outlander“) sich allein um ihn und seinen älteren Bruder kümmert. Hilfe hat sie nur von Granny (Judi Dench) und Pop (Ciaran Hinds), ihren Schwiegereltern, die Buddy abgöttisch liebt. Eines Tages, als Buddy auf der Straße spielt, wird sein Viertel von Protestanten überfallen, es fliegen Steine und Fäuste. Zwar verschwinden die Angreifer schnell wieder, doch die Nachbarschaft, die aus Protestanten und Katholiken besteht, ist danach nicht mehr dieselbe. Das merkt auch Buddy, der den Konflikt aber nicht versteht.
Denn er als Protestant hat sich nicht nur unsterblich in eine katholische Mitschülerin verliebt, er kann auch mit den gegenseitigen Anschuldigungen der beiden Konfliktparteien wenig anfangen. Viel lieber genießt er seine Zeit mit den Großeltern, Kinobesuchen, seiner Cousine Moira und den wenigen Stunden im Monat, die er mit seinem Vater verbringen kann. Doch der merkt bald immer deutlicher, dass Buddys Kindheit im zunehmend gewalttätigen Konflikt in der Stadt in Gefahr gerät. Schließlich denken Buddys Eltern über eine für die Familie folgenschwere Entscheidung nach. Und mitten hinein platzt eine Hiobsbotschaft …
Das Leben – wenn man neun Jahre alt ist
Die vielen Preise, die Belfast schon gewonnen hat, unter anderem den Golden Globe für das beste Drehbuch, finden manche Kritiker richtig und andere haben wenig Verständnis dafür. Das dürfte daran liegen, dass sich Branagh mit seiner Art, die Geschichte zu inszenieren, auf den ersten Blick angreifbar macht. Denn er erzählt seinen Film nicht nur aus der Sicht des Neunjährigen, der ihn selbst als Kind zeigt, sondern er erlaubt sich auch, seine Erinnerungen daran so verklärt zu zeichnen, wie sie bei Erwachsenen nun einmal oft sind. So sehen seine Eltern aus wie Filmstars und bewegen sich auch oft so, weil Buddy und seine Familie oft ins Kino gehen und Filme sehen. Und wenn sie zusammen sind, erscheinen sie Buddy wie das tollste Liebespaar der Welt, auch wenn Branagh die dunklen Seiten der angespannten Beziehung nicht ausspart.
Immer wieder zeigt Branagh gleichzeitig Realität und eine idealisierte Version davon und diese Doppelbödigkeit der Bilder können mitunter irritieren. Zudem sorgen sie dafür, dass sich Branagh den Vorwurf einfing, er würde über den Irland-Konflikt nicht angemessen ernsthaft berichten. Ein ziemlich unsinniger Vorwurf, da der Nordire keinen Dokumentarfilm gedreht hat. Und gerade einige Szenen, die direkt mit dem Konflikt zu tun haben, zu den stärksten Momenten des Films zählen. So macht die Anfangsszene mit dem Angriff der Protestanten unmissverständlich klar, wie viel Angst Buddy empfindet. Aber er ist eben ein neunjähriges Kind, das schon am nächsten Tag genauso traurig darüber ist, dass seine Mitschülerin ihn nicht beachtet.

Verklärte Erinnerung statt Kriegsdrama
Dass Branagh sich weigert, aus seiner filmischen Autobiographie ein reines Bürgerkriegs-Drama zu machen, ist Belfast gar nicht hoch genug anzurechnen. Denn der Regisseur und Autor interessiert sich mehr für Menschen als für Meinungen oder Ideologien. Und so zeigt er Buddy nicht als hilfloses Opfer der Umstände, sondern als starkes Kind inmitten einer beschützenden Familie, deren Opfer für ihn er oft gar nicht bemerkt. Der Konflikt ist zwar stets unterschwellig da, weil vor allem das Leben des Vaters davon stark beeinträchtigt wird, aber es bleibt im Film nur ein Teilaspekt, weil Buddys Leben eben auch andere Seiten hat – wie die glücklichen Stunden bei seinen Großeltern. Das ist je nach persönlichem Empfinden emotional packend oder kitschig, aber als Blick auf die eigene Kindheit auch nicht wirklich angreifbar.
Neben der Handlung besticht Branaghs Film aber auch durch seine Bilder. Kameramann Haris Zambarloukos, mit dem Branagh hier bereits zum achten Mal zusammenarbeitet, zeigt Belfast als kulissenhafte Schmuddel-Schönheit in edlem Schwarz-Weiß und unterstreicht damit den fast traumhaften Charakter der verklärten Erzählung. Belfast ist hier schöner als es wohl tatsächlich war. So wie jeder Ort einer glücklichen Kindheit eben schön ist, wenn wir uns daran erinnern. Die Konsequenz, mit der Branagh seine Erinnerungen kindlich überhöht, lässt den Verdacht zu, dass der Regisseur durchaus wusste, was er tat, als er diese Art wählte. Das muss man nicht mögen. Aber es wäre schon vermessen, würde man Branagh deshalb sein Können als Autor und Regisseur absprechen.
Schauspiel-Oscars?

Doch nicht nur Belfast sieht in Zambarloukos Bildern märchenhaft aus, auch die Darsteller stellt der Film auf kleine Sockel. In den kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bildern wirken Judi Dench und Ciaran Hinds nicht mehr rein menschlich, sondern fast wie steinerne Denkmäler, die als weise Ratgeber und Anker für Buddy da sind. Und denen ihr wunderbares Spiel je eine Oscar-Nominierung für die beste Nebenrolle einbrachte. Auch Caitriona Balfe und Ex-Model Jamie Dornan überzeugen als Buddys Eltern. Und spielen die leidenschaftlich Liebenden aus Sicht eines Neunjährigen mit viel Freude an Gesten und Drama. Und einer unwiderstehlichem Musical-Nummer. Belfast ist ein sehr persönlicher Film, den der Regisseur mit den Mitteln des Mainstream-Kinos erzählt. Und dagegen ist gar nichts zu sagen.
Fazit:
Mit Belfast arbeitet Regisseur und Drehbuchautor Kenneth Branagh seine eigene Kindheit in Nordirland auf. Und nutzt dabei die Mittel des Films, um aus seinen subjektiven Erinnerungen ein wunderschönes Dankeschön an seine Familie zu verschicken. In edlem Schwarz-Weiß zeigt Branagh eine Kindheit in einer schweren Zeit, die dennoch glücklich war. Und in der es auch andere Dinge gab als nur den Bürgerkrieg. All das erzählt Branagh mit einer melancholischen Leichtigkeit und ohne großes Interesse an Geschichtsunterricht. Branagh hat damit sicher keinen Film für ein großes Publikum gedreht, denn die Superhelden-Generation wird mit Belfast wenig anfangen können. Wer aber optisch und inhaltlich schönes Erzählkino schätzt, dürfte mit einem Lächeln aus dem Kino kommen.
Belfast startet am 23. Februar 2022 in den deutschen Kinos.